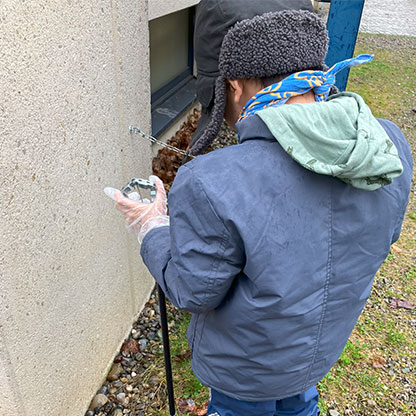«Herausforderndes
Verhalten ist Ausdruck von
massivem Stress»
Wenn Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Behinderung psychisch erkranken, zeigen sie oft stark herausforderndes Verhalten. Lisa Eckhard-Lieberherr, Oberärztin an der Fachstelle Entwicklungspsychiatrie der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, erklärt, was hinter diesem Verhalten stecken kann und weshalb es wichtig ist, bei der Therapie auch Bezugspersonen zu involvieren.

Dr. med. univ. Lisa Eckhard-Lieberherr ist Oberärztin an der Fachstelle Entwicklungspsychiatrie der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Sie ist spezialisiert auf psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Zudem ist sie als Konsiliarpsychiaterin in einer der beiden Therapeutischen Wohnschulgruppen (TWSG) im Kanton Zürich tätig. Eckhard wohnt in Zürich und ist Mutter von zwei Kindern.
www.pukzh.ch/ewp
Lisa Eckhard-Lieberherr, je nach Studie leiden 20 bis 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen an psychischen Problemen. Bei Kindern mit Behinderung liegen die Zahlen noch höher. Weshalb ist das so?
Lisa Eckhard-Lieberherr: Grundsätzlich lässt sich sagen: je schwerer die kognitive Beeinträchtigung ist und je geringer das verbale Ausdrucksvermögen der Kinder, desto eher kommt es zu psychischen Störungen. Das liegt daran, dass die kognitiven Verarbeitungsmechanismen, also etwa die Bewältigung und das Einordnen von negativen Erlebnissen, für diese Kinder schwieriger ist. Dazu kommt, dass diese Kinder ihre Bedürfnisse weniger klar äussern können; das führt häufiger zu Missverständnissen und Frustration. Ein weiterer Grund könnte sein, dass behinderte Kinder viel häufiger potenziell traumatische Ereignisse wie körperliche und sexuelle Misshandlungen erleben.
Gibt es psychische Störungen, die öfter vorkommen als andere?
Bei Kindern mit einer leichten Intelligenzminderung sind die Störungsbilder ähnlich verteilt wie bei Kindern mit durchschnittlicher Intelligenz. Da kommen Erkrankungen vor wie etwa Depression, Angststörung, soziale Phobien, Traumafolgestörung, ADHS, Autismus-Spektrum-Störung oder Störung des Sozialverhaltens. Ab mittelgradiger Intelligenzminderung häufen sich Bindungsstörungen, ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen und die sogenannten Verhaltensstörungen.
Welche psychischen Erkrankungen treffen Sie bei Ihrer Arbeit am häufigsten an?
Der Hauptanmeldegrund bei uns ist herausforderndes Verhalten. Es geht dabei um so stark selbst- oder fremdschädigende Verhaltensweisen, dass der Besuch von nicht spezialisierten Einrichtungen nicht mehr möglich ist. Oft geht dies einher mit Schreien, Blockaden, Toben, Bewegungsstörungen und stereotypem Verhalten. Wir benutzen absichtlich nicht den Begriff «aggressives Verhalten», da bei Aggression oft Absicht vermutet wird. Das ist sie in diesen Fällen meistens aber nicht.
Was steckt denn hinter herausforderndem Verhalten?
Oft ist es Ausdruck von massivem Stress oder einer unbefriedigten Bedürfnislage im sozioemotionalen Bereich. Auch Reizüberflutung, Über- oder Unterforderung kann dahinterstehen. Oder es kann auch Ausdruck sein einer anderen spezifischen Störung, die aber erst verstanden werden muss. Häufig besteht ein sogenannter Misfit zwischen der Umgebung und den Bedürfnissen des Kindes. Misfit bedeutet, dass das Umfeld, in dem das Kind lebt, nicht zu den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes passt. Es kann beispielsweise sein, dass ein Kind sozioemotional noch deutlich jünger ist als sein tatsächliches Alter – und es deshalb von seinem Umfeld ständig überfordert wird. Unser Ziel ist es, das Kind in seinem tatsächlichen Entwicklungsstand abzuholen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und das Umfeld so zu gestalten, dass es besser passt.
Wie unterstützen Sie Eltern dabei, einen solchen Misfit aufzuheben?
Wir versuchen, auf Basis der Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes zu einem besseren Verständnis für das Kind beizutragen. Wenn das gelingt, können Eltern und andere Bezugspersonen den Stress des Kindes besser verstehen und den Umgang mit dem Kind anpassen. Das kann
beispielsweise sein, dass wir den Eltern raten, für mehr Vorhersehbarkeit, mehr Struktur zu sorgen, oder dass wir sie ermutigen, die Qualität der Beziehung zum Kind weiter zu verbessern. Es geht insbesondere darum, den Fokus auf die Stärken und das bestehende Positive zu legen. Das ist wichtig, weil sich bei längerer Dauer der Schwierigkeiten die Beziehung oftmals verschlechtert hat.
Wie gut funktioniert diese Anpassung des Umfelds in der Praxis tatsächlich?
Das ist abhängig von den bestehenden Ressourcen im Umfeld. Ich erlebe sehr engagierte Eltern, Schulen und heilpädagogische Institutionen, die bereit sind, gemeinsam nochmals genauer hinzusehen, ihre Haltung zu verändern und neue Wege zu gehen. Die Finanzierungsmöglichkeiten stehen bei der Machbarkeit natürlich im Fokus. Wenn es beispielsweise gelingt, eine Eins-zu-eins Betreuung vor Ort zu organisieren, trägt das oft zur Verbesserung der Situation bei.
Aus welchen Gründen funktioniert eine Anpassung des Umfeldes manchmal nicht?
Etwa dann, wenn die Eltern selbst massiv belastet sind, sich beispielsweise aufgrund von Migrationshintergrund weniger gut hier zurechtfinden oder aufgrund von eigener Flucht- oder Traumaerfahrung oder eigener Erkrankung wenig Stabilität mitbringen. Es kann aber auch daran liegen, dass die Ressourcen in der Schule nicht ausreichen, zu wenig Lehrer:innen verfügbar sind oder zu viele Lehrer:innenwechsel stattfinden. Manchmal scheitert es auch konkret am aktuellen Mangel an Schul- oder Betreuungsplätzen, die auf Autismus oder höhergradige Beeinträchtigung ausgerichtet sind.

Ein Teil Ihrer Patient:innen sind Kinder und Jugendliche mit höhergradigen Behinderungen, die nicht sprechen können. Wie gestalten Sie Abklärung und Therapien für diese Zielgruppe?
Da gibt es bindungsorientierte Ansätze und spieltherapeutische Verfahren. Die Beobachtung und die
Auskünfte von Eltern und Bezugspersonen werden wichtiger für das Verständnis, ebenso ist eine gemeinsame Klärung der Erwartungen notwendig. Eltern oder Bezugspersonen erwarten manchmal, dass einzelne Verhaltensschwierigkeiten wegtherapiert werden können. Das ist aber kaum möglich. Viel sinnvoller für die Entwicklungs- und Bindungsförderung ist es, das Kind aus psychotherapeutischer Perspektive kennenzulernen und die Erkenntnisse den Bezugspersonen zu vermitteln. Es ist wichtiger, dass wir im Alltag ansetzen und mit aufsuchender Hilfe, also zum Beispiel mit Spitex oder sozialpädagogischer Familienbegleitung, bei der Familie zu Hause versuchen, das Umfeld für die Bedürfnisse der Kinder tragfähiger zu machen.
Aktuell besteht bei Ihnen eine Wartezeit von neun bis zwölf Monaten für eine Abklärung. Welche Erlebnisse haben die Kinder hinter sich, wenn sie dann endlich zu Ihnen kommen können?
Manche Kinder und Jugendliche haben den Schul- oder Betreuungsplatz schon verloren und müssen rund um die Uhr von einem Elternteil einszueins betreut werden. Manche Eltern verlieren dadurch ihre Arbeit. Das schwer herausfordernde Verhalten der Kinder bringt die betreuenden Eltern massiv an den Rand ihrer Kräfte. Die Kinder und Jugendlichen haben oft mehrere Monate von sehr prekären Verhältnissen ohne Tagesstruktur und ohne Therapie hinter sich.
Wohin können sich betroffene Eltern wenden, wenn sie schnell Hilfe brauchen?
Die psychologische Beratungsstelle von Insieme beispielsweise berät niederschwellig. Der Elternnotruf Zürich ist rund um die Uhr erreichbar. Wenn es sich um einen Notfall handelt, können Eltern sich an den kinder- und jugendpsychiatrischen Notfall der KJPP wenden. Und es gibt niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater:innen und -psychotherapeut:innen, die Kinder mit Behinderung aufnehmen. Häufig machen Eltern auch gute Erfahrung mit engagierten Entwicklungspädiater:innen. Es lohnt sich, konstant bei einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt zu bleiben, da sie zum Teil auch die Behandlung mit Medikamenten übernehmen können.
Welche Bedeutung haben Psychopharmaka bei Ihrer Arbeit?
Mir scheint, dass häufiger danach gefragt wird, meist als Ausdruck von grosser Hilflosigkeit. Es gibt
ein Medikament aus der Klasse der Antipsychotika, das bei sogenannten aggressiven Verhaltensstörungen bei Autismus zugelassen ist. Manchmal wirkt es aber nur vorübergehend wie eine chemische Krücke, wenn die Verhaltensstörungen eine Reaktion auf das Umfeld sind. Deshalb ist es auch hier wichtig, gleicheitig das Umfeld an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen anzupassen.
Zur Prävention: Wie können Eltern frühzeitig erkennen, dass es ihrem Kind mental schlecht geht?
Mit den Kindern in gutem Kontakt zu bleiben, mit ihnen regelmässig auch über ihr emotionales
Erleben zu reden, ist der beste Weg, eine gute Beziehung zu pflegen und zu reflektieren, wie es ihnen
geht. Beim Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung ist es hilfreich, wenn sich die Eltern selbst
Fachwissen dazu aneignen. Wenn sich ein Kind nicht gut ausdrücken kann und es stärker beeinträchtigt ist, ist es essenziell, die Kommunikation zu vereinfachen. Das heisst, es braucht mehr Zeit und mehr Einfühlungsvermögen der Bezugspersonen, um das Kind in seiner Erlebniswelt wahrzunehmen.
Wann ist externe Hilfe nötig?
Dann, wenn vergeblich versucht wurde, das Umfeld an das Kind anzupassen, oder wenn die Bezugspersonen erkennen, dass sie mit ihren vorhandenen Möglichkeiten das Kind nicht abholen können. Das heisst nicht, dass es in jedem Fall eine Psychotherapie braucht. Ich empfehle, sich zuerst an bereits involvierte Fachpersonen, beispielsweise auch aus der Heil- und Sozialpädagogik, zu wenden. Auch sie können helfen, die Situation und das Kind besser zu verstehen.
Was ist Ihre Erkenntnis aus den fünf Jahren als Oberärztin in der Entwicklungspsychiatrie?
Ich erlebe tagtäglich, dass die Eltern von Kindern mit Behinderungen eine grossartige, weil schwierige
Arbeit leisten. Kinder mit einer Behinderung haben oft viel länger Bedürfnisse aus dem kleinkindlichen
Bereich. Zudem müssen die Eltern meist zusätzliche Termine wahrnehmen und mit dem schwierigen Verhalten ihrer Kinder in der Öffentlichkeit zurechtkommen – wo sie dann auf mehr oder weniger Verständnis stossen. Für diesen Kraftakt erhalten diese Eltern viel zu wenig Wertschätzung und Unterstützung von der Gesellschaft. Deshalb bin ich der Meinung, dass es noch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich braucht.
Notfall, hilfreiche Adressen und Beratung
Elternnotruf rund um die Uhr
Tel. 0848 35 45 55
E-Mail: 24h@elternnotruf.ch
Chat und Info: www.elternnotruf.ch
Psychiatrischer Notfall-Dienst
Bei akuten psychischen Krisen bei Kindern und Jugendlichen hilft der Notfalldienst der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Tel. 058 384 66 66
www.pukzh.ch
Psychologisch-psychotherpeutische Hilfe, spezialisiert auf Kinder mit Behinderung
Die Praxis Spielzeit in Zürich bietet Psychotherapie und psychologische Begleitung für Menschen mit Krankheit, Trauma und Behinderung.
www.spielzeit.ch
Beratung
Die Fachstelle Lebensräume von Insieme Schweiz bietet psychologische Beratung an für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und ihre Angehörigen.
www.insieme.ch/psychologische-fachstelle
Suche nach Therapieplätzen
Unterstützung bei der Suche nach freien Therapieplätzen im Kanton Zürich bietet die Website: www.therapievermittlung.ch
Interview: Regula Burkhardt
Bilder: zvg, Adobe Stock